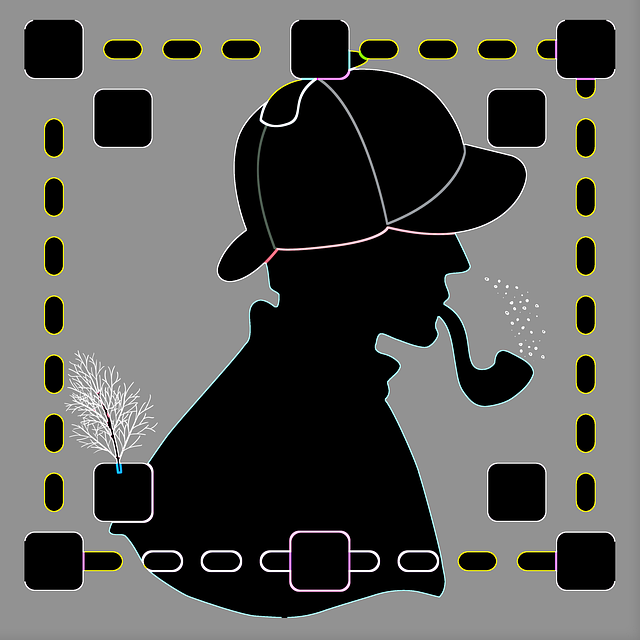Es ist nicht einer der geringsten Vorzüge der Geschichten um Sherlock Holmes, dass sie sich oft zu aphoristischen Perlen verdichten, die man gerne weiterverwendet. „Ich bin ein Gehirn, Watson. Der Rest von mir ist bloßes Anhängsel“, lässt der Detektiv einmal verlauten. Als Gehirn ist er wie sein Vorgänger, E.A. Poes Dupin, ein Vertreter des schärfsten Rationalismus. Jede Form des Aberglaubens, jedes übernatürliche Phänomen wird als nur scheinbar entlarvt. Der Hund von Baskerville ist kein dämonisches Ungeheuer, sondern ein Hund. Als Conan Doyle, ein in Südengland praktizierender Arzt, die Denkmaschine Holmes in die Welt setzte, ahnte er nicht, welche Erfolge sie ihm einbringen würde; allerdings auch nicht die Belastungen. Nach vielen scharfsinnigen Geschichten wurde er des Detektivs überdrüssig und ließ ihn in einem denkwürdigen Duell mit seinem Todfeind, Prof. Moriarty, an den Reichenbach-Fällen in der Schweiz verschwinden. Jahre zuvor hatte Doyle hier noch das nordische Skifahren eingeführt. Doch das Publikum wollte sich nicht an den Tod von Sherlock Holmes gewöhnen und rief nach mehr.
„Sherlock Holmes und die Elfen“ weiterlesen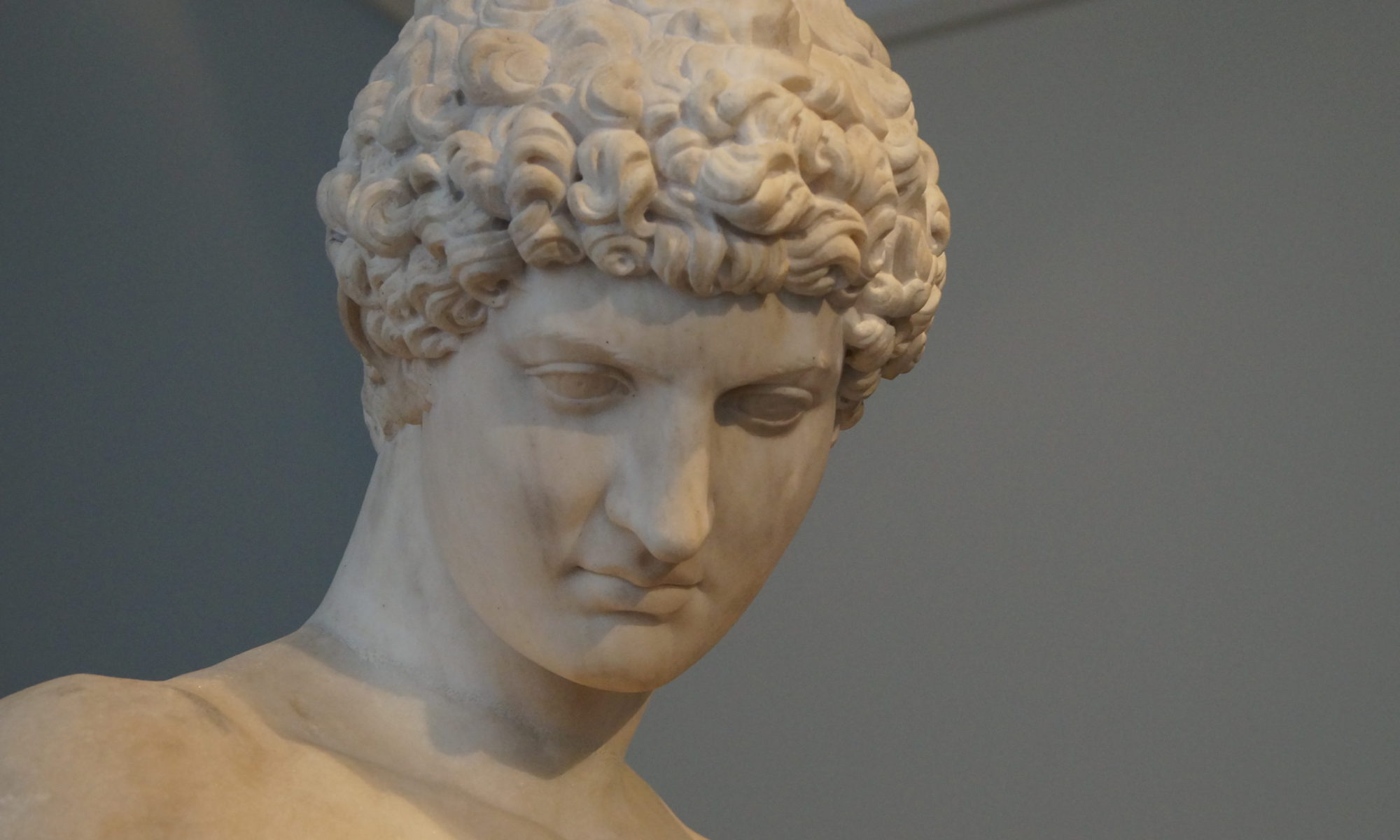

Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.
gegründet 1995