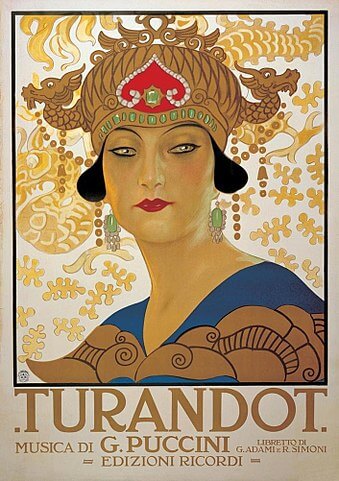„Hinter ihren Schwertern fließt Blut.“ (Das Nibelungenlied)
Sommer. Sonne. Spiele. Auch vor Worms macht die Hitze nicht Halt, kein Bollwerk, das die Wärme stoppt; alles ist durchlässig. „Alles fließt“, heißt es in der berühmten Formel des griechischen Philosophen Heraklit (ca. 520 – ca. 460 v. Chr.), panta rhei (altgriech. πάντα ῥεῖ). Oder präzisier (bei Platon überliefert): „Alles fließt [bewegt sich fort] und nichts bleibt“ (altgriech. Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει; Vgl. Kratylos 402A = A6). Und es sind nicht nur die Wärme, der Sommer, die Zeit, die stetig dahinströmen wie der Rhein, nein, es fließt auch das Blut. Bei Amazon Prime einmal mehr fiktiv-brachial in Szene gesetzt durch die neue Roland-Emmerich-Gladiatoren-Serie „Those About to Die“, in Worms dagegen fließt es für den Zuschauer live und erlebbar bei den Nibelungen-Festspielen. Dort, auf der Bühne vor dem Wormser Dom St. Peter, wird in munterer Reihenfolge das (Kunst-) Blut vergossen, weggeschrubbt, untersucht, sich damit beschmiert, darin gewatet, als sei die Erde, der Himmel, jeder Gedanke aus Blut, im Blut, mit dem Blut. Und am Ende – warten keine genähten Wunden, keine geheilten Narben. Keine Versöhnung. Nur Blut. Das einfach nicht aufhören will zu fließen.
„Die (postmodernen) Nibelungen: Blut und Spiele“ weiterlesen