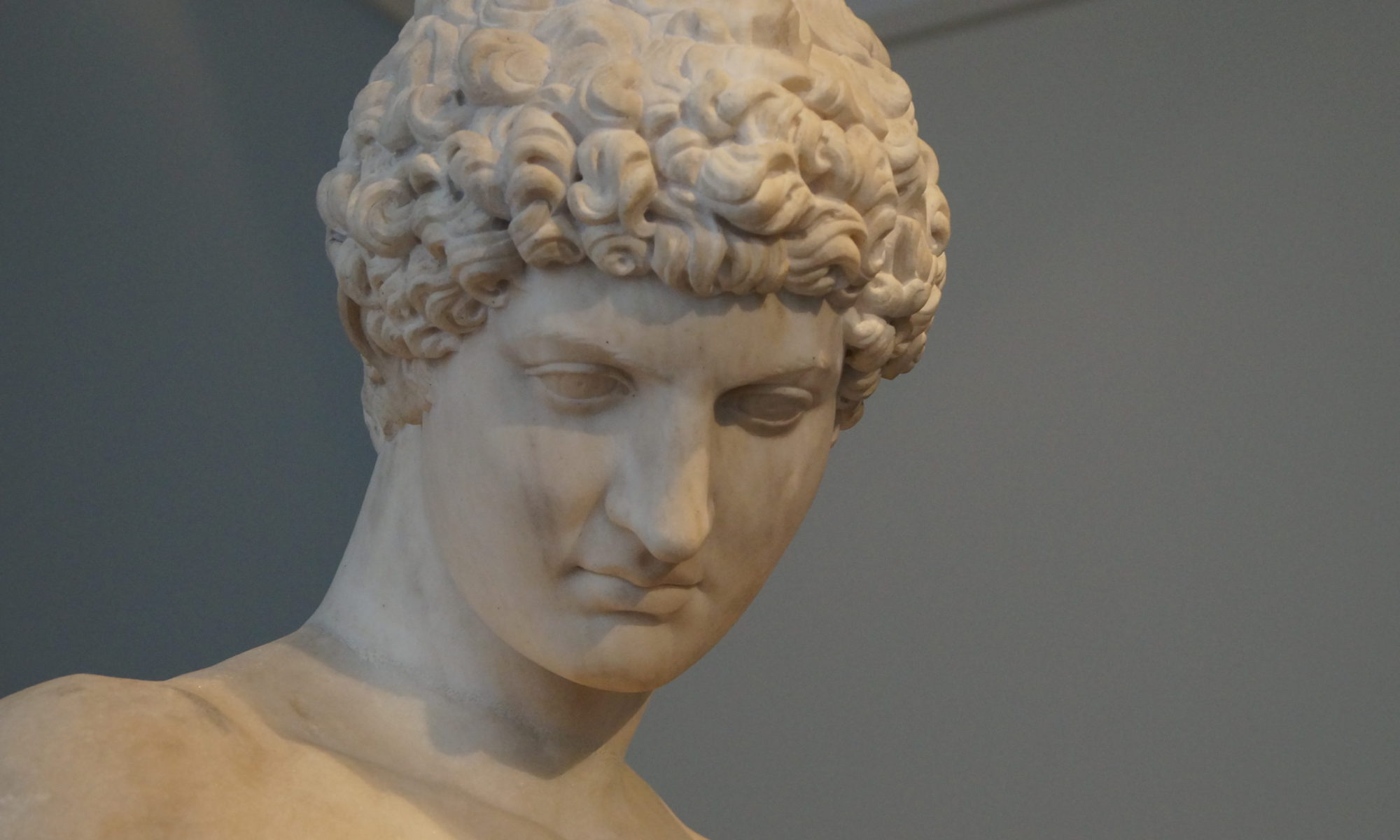Er war einer der großen Götter der Aufklärung. Voltaire sah in ihm den Beginn der Moderne; ein Genie wie Isaac Newton werde nur einmal alle tausend Jahre geboren: „Vor Kepler waren alle Menschen blind. Kepler hatte ein Auge, Newton zwei.“ Und der Dichter Alexander Pope machte diesen Vers, der den Wissenschaftler in die Nähe Gottes rückte.:
„In tiefer Nacht, Natur, Gesetz zu sehen nicht.
Gott sprach, lass Newton sein! Und es ward Licht.“
Newtons Optik erklärt die Natur des Lichtes und damit wurde er zum Träger der zentralen Metapher der Aufklärung, zum Lichtträger, der allerdings lateinisch auch Luzifer heißt. In seinem Hauptwerk Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) gibt er den Bewegungen des Universums ein mathematisches Kleid. Astronomie und Mathematik werden hier versöhnt und die Gravitationskraft als der Schlüssel erkannt. Die drei Keplerschen Gesetze gießt er in eine elegante, vereinheitlichende Formel und gibt somit dem kopernikanischen Weltbild sein mathematisches Fundament. Auf diesem Fundament wird sich die Wissenschaft der nächsten zweihundert Jahre errichten. Er wird bis heute als der größte Wissenschaftler aller Zeiten angesehen, denn er war nicht nur Physiker, Astronom und Mathematiker, sondern auch der oberste Aufseher der britischen Währung und als Präsident der Royal Society der mächtigste Mann in der Verwaltung von Wissenschaft. Oft wird Einstein mit ihm verglichen, doch müsste dieser, um Newton auch nur annähernd das Wasser reichen zu können, neben seinen Leistungen als Physiker noch als Ingenieur und Handwerker Meriten haben, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft sein, sowie der Bundesbank vorstehen. Auch wenn Newton seine Feinde hatte wie William Blake, Samuel Taylor Coleridge oder Johann Wolfgang Goethe, der in seiner Farbenlehre gegen ihn wetterte, so wurde er doch vor allem verehrt. Die Französische Revolution gab ihm das Profil eines Erlösers. Man warf den Briten vor, dass sie ihren Gott nicht gehörig ehrten. Champlain de la Blancherie schlug vor, einen neuen Menschheitskalender zu beginnen, der mit dem Jahre 1642 einsetzen sollte, Newtons Geburtsjahr. Étienne-Louis Boullée entwarf 1784 ein Mausoleum für Newton in der Form einer gigantischen Kugel. Selbst die Theologie konnte der Physik Newtons etwas abgewinnen, ja, sie machte sich diese zu ihrer Dienerin. John Craig wendete 1699 die Gesetze der Bewegung von Körpern auf psychische Zustände an und errechnete mit Newtons Gesetzen die Geschwindigkeit der Entstehung von Verdacht und Misstrauen. Weiterhin kalkulierte er die Geschwindigkeit der Abnahme des christlichen Glaubens. Damit wiederum konnte er die Wiederkehr Christi berechnen; sie wird im Jahre 3150 stattfinden.
Newton stand für die Berechenbarkeit aller Phänomene, von der Chemie bis zu den Sozialwissenschaften. Newton ist, so will es dieses öffentliche Bild, die Neuzeit. Noch das Bild des Apfels, das mit ihm assoziiert wird, macht ihn zu einem zweiten Adam, und wurden nicht beide mit den Gesetzen des Falles konfrontiert? Ob dieser Apfel übrigens je gefallen ist, um ihm die entscheidende Einsicht zu bringen, als er sich während der Pestzeit auf das Land zurückgezogen hatte, werden wir nicht wissen. Die Anekdote wurde von ihm selbst viele Jahre später erzählt und könnte gerne eine Übertreibung sein. Aber sie gehört zu seiner Ikone wie der wilde Haarschopf und die ausgestreckte Zunge zu Albert Einstein. Newtons Konterfei schmückte eine Briefmarkenserie ebenso wie britische Banknoten der siebziger Jahre. Das Bild des Aufklärers hielt sich in der Fachwelt bis weit ins 20. Jahrhundert; im allgemeinen Bewusstsein hält es sich bis heute.
Doch in den letzten fünfzig Jahren hat man begonnen, das Profil des Stammvaters der Neuzeit in einem anderen Licht zu sehen. Mit einem Gepäckstück fing alles an. Als Newton 1727 starb, hinterließ er einen Koffer mit einem Stapel von Aufzeichnungen und Manuskripten, insgesamt etwa 25 Millionen Wörter. Die Enttäuschung war groß, als man sich diese Blätter genauer anschaute. Zwar gab es mathematischen und physikalische Texte, doch die Mehrzahl widmete sich ganz anderen Dingen: der häretischen Theologie des Arianismus, dem Elixier des Lebens, dem Stein der Weisen, der Apokalypse und den biblischen Propheten. Als dem Herausgeber der Werke Newtons, Bischof Samuel Horsley, der Koffer gezeigt wurde, schlug der die Hände über dem Kopf zusammen. Er schloss ihn sofort wieder und verlor kein Wort mehr über dieses ketzerische Konvolut. Der Nachlass wanderte durch verschiedene Hände von Erben, wurde inventarisiert, Teile wurden ausgesondert und verkauft, der Rest verblieb in dem Schloß eines Nachfahren. Die Wissenschaftler und Institutionen, denen man den Nachlass anbot, wollten nichts davon wissen. 1936 gelangten die Papiere endlich auf den Tisch des Auktionshauses Sotheby’s. Bei der Versteigerung erwarb der berühmte Ökonom John Maynard Keynes die Manuskripte alchemistischen Inhaltes und schenkte sie dem King’s College in Cambridge. Andere Manuskripte wurden weit über die Welt verstreut. Der theologische Teil etwa ging an die Universität von Jerusalem und wird erst heute ausgewertet.
Einige Biographen behaupten nun, der eigentliche Newton sei der Alchemist und Theologe, weil er aus diesem unsichtbaren Fundament seine mathematisch-wissenschaftlichen Prinzipien erarbeitet habe. John Maynard Keynes sah in diesem Newton den „letzten Babylonier“, einen Forscher, der sich der langen Reihe der Astronomen, Astrologen und Mathematiker von den Sumerern und Griechen her zugehörig fühlte und der in seinen Erkenntnissen nur eine Wiederentdeckung des Wissens der Alten sehen wollte. War er der Letzte oder der Erste? Er war beides, aber in keiner anderen Gestalt kam diese komplexe Mischung der alten und der neuen Welt so spannungsreich zur Geltung.
Newton war ein Einzelgänger. Sein Motto lautete: Wahrheit ist ein Abkömmling aus Schweigen und unaufhörlicher Meditation. Er wurde am Weihnachtsmorgen 1642 in Lincolnshire geboren. Das Datum war ihm nicht unwichtig, denn in seinen geheimen Spekulationen sah er sich dem Erlöser nah, mit dem er den Geburtstag teilte. Später machte er im Rahmen seiner kabbalistisch-numerologischen Studien die Feststellung, dass sich aus der lateinischen Schreibweise seines Namens ISAACUS NEUUTONUS das Anagramm IEOUA SANCTUS UNUS ziehen lässt: der Eine Heilige Yahwe – eine Botschaft, die ihn in seiner Religion bestärkte. 1642 ist ein dramatisches Jahr für England. Ein Bürgerkrieg bricht aus, aus dem der Puritaner Oliver Cromwell als Sieger hervorgeht. Newtons erste Lebenshälfte wird von weiteren dramatischen Ereignissen überschattet. Ein weiterer Bürgerkrieg wird folgen, das Ende der puritanischen Herrschaft, 1660 die Restauration der Monarchie, London wird von einer schlimmen Pest heimgesucht und brennt 1666 nieder. Aus dem alten London wird das neue aus der Asche erstehen, das London der Neuzeit. 1688 eine blutlose Revolution: Rückkehr einer protestantischen Monarchie, die nun konstitutionell sein wird. Dann aber wird England endgültig zur Welt- und Kolonialmacht aufsteigen.
Seine Mutter gibt den Knaben nach dem frühen Tod des Vaters in den Haushalt von Verwandten; als Gymnasiast wohnt er in Grantham bei einem Apotheker, dessen Bücher und Geräte ihm Chemie und Pharmazie, aber auch Alchemie und Theologie nahe bringen. Isaac ist sehr geschickt und baut sich unter anderem eine Mühle, die von Mäusen angetrieben wird, sowie eine an einem Drachen hängende Laterne, mit der er nachts die Nachbarn in Schrecken versetzt. Er ist auch ein begabter Zeichner und bedeckt die Wände seines Dachzimmers mit Illustrationen aller Art. Newton studiert in Cambridge und schafft sich zunächst vor allem theologische Bücher an. Er beschäftigt sich mit Geometrie, allerdings auch unter dem Blickwinkel der Astrologie. So kauft er sich 1663 ein Buch des italienischen Mathematikers und Astrologen Cardano, eines Abenteurers, über den es hieß, er werde eher sterben, als seinem Horoskop unrecht geben. Cardano stellt auch Bezüge her zwischen den Propheten und der Mathematik – eine Beziehung, die Newton fasziniert. Newton versucht sich mit Hilfe Cardanos ein Horoskop zu erstellen, scheitert dabei und nimmt sich nun vor, sich eingehender mit der Geometrie zu beschäftigen, um dieses Problem zu lösen. In Cambridge baut er erste Kontakte auf zu Alchemisten und Philosophen mit spiritualistischen Einstellungen wie Henry More. Henry More war zunächst Anhänger, später Kritiker Descartes’, dessen Materialismus ihn abstieß. More prägte wohl als erster den Begriff einer „vierten“, das heißt spirituellen Dimension.
1666 findet eine Massenflucht aus Cambridge statt: Die Pest hat auch die Universität erreicht. Newton zieht sich in seine Heimat, nach Woolthorpe in Lincolnshire zurück. 1666 wird für ihn das berühmte annus mirabilis. In einem Obstgarten will er den fallenden Apfel mit dem Mond in Verbindunggebracht und so die Gesetze der Schwerkraft entdeckt haben. Auch die Ideen für sein anderes Hauptwerk, die Optik, in dem er die Natur des Lichtes analysiert, sind in diesen ein bis zwei Jahren entstanden. Nach seiner Rückkehr nach Cambridge beginnt er sich intensiv mit Alchemie zu beschäftigen – und zwar die nächsten dreißig Jahre lang. Er kauft Manuskripte und Bücher der entlegensten Art, kopiert und zeichnet sie ab, kommentiert sie und versucht sie, durch Experimente zu bestätigen. Seine eigenen Notizen sind oft nicht zu entziffern, er verwendet Geheimzeichen und versucht soviel wie möglich zu verschleiern.
Bis heute wissen wir nicht genau, warum er diese Forschung betrieben hat. Newton war umfassender in der Alchemie gebildet als irgendein anderer Geist seiner Zeit. Er entzifferte und studierte die hermetischen Schriften eines Michael Maier, Sendivogius, Sir George Ripley, Philalethes oder Nicholas Flamel (der durch Harry Potter wieder ein wenig ins Bewusstsein zurückgekehrt ist) und legte sich eigene chemisch-alchemistische Wörterbücher an, in denen er 100 Autoren und 150 Werke zitierte und an die 900 Eintragungen machte. Michael Maiers emblematische Illustrationen zur Alchemie übersetzte er in die Sprache des praktischen Experiments. Wenn die Alchemisten von den Tauben der Diana oder Jupiters Adler sprechen, von den Drachenzähnen, dem Brau der Medea, dem verzauberten Bullen oder dem Horn der Amalthea, so hat das für Newton alles einen versteckten Sinn, den es zu dekodieren gilt. Mit seinem Gehilfen Humphrey Newton verbrachte er viele Nächte vor dem Schmelzofen, den er in seinem privaten Labor im Garten des Trinity College betrieb. Fast niemand sonst durfte Einblick in diese geheime Tätigkeit erhalten, und selbst Humphrey verstand letztlich nicht, was der Meister eigentlich damit zu erreichen suchte. Wollte er Gold machen, suchte er den Stein der Weisen, das Elixier des ewigen Lebens? Wir wissen es nicht. Aber soviel lässt sich sagen: Newton sah in der Alchemie einen Naturbegriff, den er teilte und der für seine Physik und Optik entscheidend war. Es ist die Vorstellung einer alles durchwaltenden Kraft, eines Geistes, der die Bewegungen in Himmel und Erde regiert. Die Suche nach dem Prinzip der Einheit der Natur ist bis heute die wichtigste Motivation für physikalisches Fragen. Wie die Alchemisten verfolgten Newton und seine Nachfolger die Einheitsformel. Alchemie ist jedoch auch Teil eines hermetischen Denkens, in dem der Rhythmus der Zahlen eine entscheidende Rolle spielt. Die Alchemie reproduziert kosmische Zyklen auf der Erde und bestätigt die Zwillingsnatur von Mikro- und Makrokosmos. Die Bewegungen der Planeten und die Harmonien der von Menschen erzeugten Musik sind von denselben Grundmustern geprägt. Diese Erkenntnis des Pythagoras war für die Alchemisten wie für Newton der Hinweis auf die geheime Struktur des Universums. Newton studierte die Schriften der Alten und sah sich mit seinen eigenen Forschungen zur Gravitation, Astronomie und Optik in einer langen Reihe stehen. Eigentlich, so war er überzeugt, wussten die Alten schon alles: dass die Erde rund ist, sich um die Sonne dreht und dass die Schwerkraft sich proportional zum inversen Quadrat der Entfernung verändert. Hermes glaubte an das kopernikanische System ebenso wie Pythagoras die Gravitation kannte. Gravitation hatte nur einen anderen Namen: die Pansmusik. Wenn Pan die Flöte spielte, setzte er Gottes harmonikale Muster in die Schöpfung um. Mit Platon konnte der Engländer sagen, alle Erkenntnis ist nur eine Form der Erinnerung.
Aber nicht Griechenland war für ihn der eigentliche Ursprungsort des modernen Denkens, sondern der biblische Raum. Pythagoras soll nach einer Legende in Phönizien den Nachkommen eines gewissen Moschus besucht und von ihm die Lehre der Atomistik gelernt haben. Dieser Moschus kann nach damaliger Ansicht kein anderer als Moses gewesen sein. Newton folgte dieser Meinung, indem er sich auf die Seite der Alten schlug. Im Kampf der Alten gegen die Neuen, dem battle of the books (Swift) oder der querelle des anciens et des modernes, war er – theologisch gesehen – auf der Seite des Alten. Die apokalyptische Gesinnung seiner Zeit war ihm selbst sehr vertraut. So glaubte man auch, dass nicht nur der Antichrist kurz bevor stehe oder sich in der Form des Papstes schon betätigte, sondern dass die Wiederentdeckung des adamitischen Wissens das nahende Ende der Welt signalisierte. So war Newton kein Fortschrittsdenker, sondern bewegte sich in mittelalterlichen Konzepten, denen er seine mathematische Kompetenz an die Seite stellte. Insbesondere interessierten ihn die Angaben über den Tempel Salomons, in dem er mehr sah als ein Gebäude. Er enthielt für ihn vielmehr in Form eines Codes eine Botschaft, ein Diagramm des höchsten Wissens, das den Menschen möglich war – ähnlich wie jene Scheibe, die die Menschen des 20. Jahrhunderts in den Weltraum geschickt haben, um künftigen Entdeckern Grundaussagen über die Bewohner der Erde zu machen. Die Dimensionen und Proportionen des Bauplans enthielten für Newton Zeitskalen und prophetische Angaben in geometrischer Verschlüsselung. Der Tempel repräsentierte das Sonnensystem mit seinem Feuer und den darum kreisenden Planeten. Die Tempelmaße in Verbindung mit anderen prophetischen Schriften erlaubten es ihm, eine komplette Chronologie der Ereignisse bis in das Jahr 2370 n.Chr. zu machen. Nach diesen Berechnungen war die Römische Kirche im 17. Jahrhundert im Abstieg begriffen. Das Jahr 1899 sieht die Rückkehr der Juden nach Jerusalem vor. Tatsächlich wurde 1897 der Zionistische Weltbund gegründet und die Juden begannen Ende des 19. Jahrhunderts aus aller Welt nach Palästina zu ziehen. Für 1944 sieht Newtons Chronologie das Ende der „Großen Judenverfolgung“. Für 1948 prophezeite er die Wiederkunft Christi und für 2436 die „große Reinigung des Heiligtums“, der eine tausendjährige Epoche des Friedens folgen würde. Auch das Himmlische Jerusalem ist für ihn keine leere Formel. Nach den Propheten ist dies ein Würfel, in dessen Mitte der Thron Gottes steht. Newton erkennt, dass es sich um das Sonnensystem handelt und berechnet es. Mit anderen Worten, das Sonnensystem ist ein heiliger Ort, der in den Schriften geweissagt wurde. In der Mitte steht Gottes Thron, die Sonne. Und was ist Schwerkraft eigentlich? Wir wissen es bis heute nicht oder nur undeutlich. Für Newton war es eine geistige Kraft, die auf Gott zurückging.
Die Heilige Schrift gab Newton Sicherheit und ein gutes Gewissen für seine Erkenntnisse in Physik, Astronomie und Optik. Theologie wie Alchemie gaben seinen Forschungen den eigentlichen Sinn. Einstein hat einmal geschrieben, der Wissenschaftler wisse ohne das Irrationale nicht, wohin er gehen, noch was er suchen solle. Als Newton gegen Ende des 17. Jahrhunderts mit großen öffentlichen Ämtern versehen wurde – oberster Chef der britischen Münze, Präsident der Royal Society -, gab er seine experimentell-alchemistische Forschung zwar auf, nicht aber den Glauben. Und er hütete sich weiterhin, auch nur Andeutungen davon an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen.
Aus heutiger Sicht erscheinen uns Newtons geheime Interessen als verschroben: als Dunkelkammer in seinem großen Bau der Vernunft. Aus Newtons Sicht sind aber genau diese Interessen nicht obskur; vielmehr bilden sie die wohldurchdachte quadratische Form eines Hauses, dessen Dach noch schräg ist – und dieses Dach ist die neuzeitliche Wissenschaft. Wie kein anderer war sich Newton selbst der Beschränktheit dieses wissenschaftlichen Standpunktes bewusst – nicht anders als sein Nachfahre Einstein. Einmal verglich er seine wissenschaftlichen Entdeckungen mit den Kieseln, die ein Junge am Strand findet, während der große Ozean der Wahrheit noch völlig unentdeckt vor ihm liegt.
Ein Beitrag von Prof. Elmar Schenkel
Jean-Paul Auffray, Newton ou le Triomphe de l’alchimie. Paris : Le Pommier-Fayard 2000.
Federico Di Trocchio, Newtons Koffer. Querdenker und ihre Umwege in die Wissenschaft. Reinbek: Rowohlt 2001.
Betty Jo Dobbs, The Foundations of Newton’s Alchemy, Cambridge: Cambridge University Press 1975.
John Fauvel, R. Flood et al, eds., Let Newton Be! A new perspective on his life and works. Oxford: Oxford University Press 1988.
Niccoló Guicciardini: Newton. Ein Naturphilosoph und das System der Welten. Spektrum der Wissenschaft: Biografie, Heidelberg 1999.
Michael White, Isaac Newton. The Last Sorcerer. Reading, Mass.: Addison Wesley 1997.
Überarbeitete Version eines Essays, der in Elmar Schenkel, Die elektrische Himmelsleiter, München: C.H. Beck 2005, erstmals abgedruckt wurde.
© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.