Es ist nicht einer der geringsten Vorzüge der Geschichten um Sherlock Holmes, dass sie sich oft zu aphoristischen Perlen verdichten, die man gerne weiterverwendet. „Ich bin ein Gehirn, Watson. Der Rest von mir ist bloßes Anhängsel“, lässt der Detektiv einmal verlauten. Als Gehirn ist er wie sein Vorgänger, E.A. Poes Dupin, ein Vertreter des schärfsten Rationalismus. Jede Form des Aberglaubens, jedes übernatürliche Phänomen wird als nur scheinbar entlarvt. Der Hund von Baskerville ist kein dämonisches Ungeheuer, sondern ein Hund. Als Conan Doyle, ein in Südengland praktizierender Arzt, die Denkmaschine Holmes in die Welt setzte, ahnte er nicht, welche Erfolge sie ihm einbringen würde; allerdings auch nicht die Belastungen. Nach vielen scharfsinnigen Geschichten wurde er des Detektivs überdrüssig und ließ ihn in einem denkwürdigen Duell mit seinem Todfeind, Prof. Moriarty, an den Reichenbach-Fällen in der Schweiz verschwinden. Jahre zuvor hatte Doyle hier noch das nordische Skifahren eingeführt. Doch das Publikum wollte sich nicht an den Tod von Sherlock Holmes gewöhnen und rief nach mehr.
Zehn Jahre später ließ Doyle ihn noch einmal auferstehen. Dies zeigt, dass die höchste Form der Rationalität sich wieder dem Übernatürlichen annähert. Denn es gilt hier ein Paradox zu lösen. Kennt man nur die Geschichten um Holmes, so müsste man denken, der Autor selbst sei ein Verfechter von Wissenschaft und Vernunft. Das war er sicher auch, doch zugleich beschäftigte er sich mit den übernatürlichen Rändern der Wissenschaft. Er kam aus einer schottischen Familie, sein Vater war zeitweise Alkoholiker, sein Onkel Richard Doyle ein anerkannter Zeichner und Maler von Elfen, der allerdings in der Heilanstalt endete. Keltische Fantasie, Glaube und Aberglauben durchwirkten die Tradition im Hause; Geisteskrankheit drohte als Gefahr. Diese Konstellation führte bei Arthur Conan zu einem geschärften Sinn für alles Psychische. Nicht selten bewährt sich auch sein Detektiv als Kenner der menschlichen Psyche, als Vorläufer von Sigmund Freud, wenn seine Klienten erst einmal auf seiner Couch Platz nehmen und ihren Fall darlegen. Wie der Psychoanalytiker achtet der Detektiv auf die Symptome der alltäglichen Pathologie. Dass Doyle sich früh auch für spiritistische Phänomene wie Spukhäuser, Trancen, Medien und Séancen interessierte, war um die Jahrhundertwende gar nicht so ungewöhnlich, zumal auf den britischen Inseln. Auch große Wissenschaftler wie die Physiker Sir William Crookes und Sir Oliver Lodge oder der Biologe und Mitentdecker der Evolution A.R. Wallace beschäftigten sich ernsthaft mit dem Paranormalen. Seit im Jahre 1848 in dem amerikanischen Städtchen Hydesville/ New York die Geschwister Fox das Klopfen von Geistern gehört hatten, hatte sich eine Welle spiritistischer Begeisterung über die gesamte westliche Welt ausgebreitet. Es gehörte zum guten Ton, an einer Séance teilgenommen zu haben. Der Okkultismus verbreitete sich auch in neuen religiösen Sekten und esoterischen Schulen wie der Theosophie.
Conan Doyle war zunächst interessiert, blieb aber skeptisch. Doch während des Ersten Weltkriegs änderte sich seine Einstellung, wie übrigens bei vielen anderen. Über dem Schlachtfeld von Mons wollen englische Truppen gigantische Engel gesehen haben, die eine Wende in der Schlacht brachten. Die Russen sahen eine Ikone der Madonna in ihren Visionen. Der Krieg konfrontierte plötzlich fast alle Europäer mit dem Tod. Das Leiden brachte viele Menschen dazu, an ein Fortleben nach dem Tod zu glauben; zugleich entstand oft der Wunsch, mit den Toten Kontakt aufzunehmen. Auch die Doyles hatten viele Verluste in ihrem Umkreis zu beklagen. Eine Bekannte von Doyle, Lily Loder-Symonds, hatte mediumistische Fähigkeiten und überbrachte Nachrichten von dreien ihrer gefallenen Brüder. Doyle war immer kritisch gewesen, aber das vorliegende Ereignis stimmte ihn um. Von nun glaubte er an ein Leben nach dem Tode. Als es ihm 1919 selbst gelang, mit seinem gefallenen Sohn Kingsley in Kontakt zu treten, war der Durchbruch in diese geistige Welt für ihn vollzogen. Von nun an sah er sich als Missionar für das neue Wissen von einer anderen Welt, die sich zunehmend manifestieren sollte. Er dokumentierte zahlreiche Fälle von solchen Kontakten, von Materialisationen und Botschaften, die von Medien in Trance gestammelt wurden, setzte sich aber auch mit den vielen Schwindlern und Scharlatanen auseinander, die diesen Verkehr mit dem Jenseits in Verruf brachten. Man fischte durchaus im Drüben, wie Walter Benjamin einmal sagte. Doyle sammelte und untersuchte Fotos, auf denen merkwürdige Erscheinungen gebannt waren: lang Verstorbene tauchten mitten im Bild auf. Am sonderbarsten das Foto, das bei einer großen Versammlung zum Gedenken an die Toten des Krieges am 11. November 1922 in Whitehall von dem Medium Mrs. Deane gemacht wurde. Auf diesem Bild schweben Gesichter über der Menge, von Doyle und anderen schnell als die von gefallenen Soldaten ausgemacht. Als man in ihnen zwei Jahre später die Gesichter von lebenden Fußballspielern und Sportlern identifizierte, wollte Conan Doyle dies nicht wahrhaben und veranlasste weitere Untersuchungen.
Solche Rückschläge gab es immer und wenn sie auch seine Gegner mit Schadenfreude erfüllten, so ließ er doch nicht ab in seiner Kampagne für die Offenbarung einer geistigen Welt. Er war kämpferisch und forderte immer wieder das materialistische Establishment heraus. So machte er sich auf zu anstrengenden Vortragsreisen in Europa, Amerika und Australien und sprach oft vor Tausenden. In öffentlichen Debatten mit Rationalisten und Atheisten schlug er sich souverän, was selbst seine Gegner anerkannten. Insbesondere in einer Debatte mit dem scharfzüngigen Kritiker John McCabe am 11. März 1920 in der Londoner Queen’s Hall hatte sich Conan Doyle tapfer und kenntnisreich behaupten können, was seine Stellung um einiges festigte. Dann geschah etwas, das ihn fast seinen Ruf gekostet hätte: die Elfen stellten ihm ein Bein. Am Ende der Affäre konnte man Schlagzeilen lesen wie „Poor Sherlock Holmes, Hopelessly Crazy?“
Alles hatte 1917, drei Jahre zuvor, in einem einsamen Tal in Yorkshire begonnen, im Dorf Cottingley – eigentlich nicht der schlechteste Schauplatz für eine kleine Holmes-Geschichte. Die sechzehnjährige Elsie Wright lieh sich eines schönen Sommertags die neue Kamera ihres Vaters aus und ging mit ihrer zehnjährigen Kusine Frances Griffiths an den Fluss hinter ihrem Haus, um, wie sie sagte, „die Elfen zu fotografieren.“ Der gute Vater gab ihnen die Kamera und dachte nicht weiter darüber nach, da die Mädchen schon öfter von diesen Elfen gesprochen hatten. Eine Stunde später kehrten die beiden in bester Laune zurück. Als der Vater abends das Negativ auf der Glasplatte entwickelte, trat ihm ein merkwürdiges Bild entgegen. Elsie, die dabei anwesend war, rief aufgeregt zu ihrer Kusine: „Oh, Frances, die Elfen sind auf der Platte!“ Auf dem Bild war die kleine Frances zu sehen, die durch eine Gruppe von kleinen geflügelten Wesen hindurchschaute. Zwei Monate später folgte ein weiteres Bild dieser Art. Vater Wright nahm es nicht sonderlich ernst, sondern sagte nur als nüchterner Yorkshire-Mann: „Ihr führt da wohl was im Schilde!“
Zwei Jahre darauf begann sich Elsies Mutter für die Theosophie zu interessieren, jene Glaubensrichtung, die Hinduismus und Buddhismus mit westlicher Evolutionslehre verbindet und durch die geheimnisvoll-umstrittene Russin Madame Blavatsky verkörpert wurde. Mrs. Wright ließ einem Theosophen gegenüber durchblicken, ihre Tochter habe da einmal Fotos von Elfen geschossen. Eine Nachricht, die hier auf fruchtbaren Boden fiel. 1920 meldete sich der theosophische Bauunternehmer Edward L. Gardner, der an Elfen und Kobolde glaubte, und bekundete großes Interesse an den Fotos. Bald hatte er Kopien von ihnen, die er, nach einigen Retuschen, auf seinen Dia-Vorträgen zeigte. Zufällig war Sir Arthur Conan Doyle zu dieser Zeit dabei, einen Artikel über Elfen für die Zeitschrift The Strand zu schreiben, als ihm die Fotos zu Ohren kamen. Der Zufall schien ihm eine Bestätigung dafür zu sein, dass er auf der richtigen Fährte war. Gardner begann, ihn mit Hintergrundinformationen zu versorgen. Während Doyle einer langen Vortragsreise in Australien und Neuseeland, blieb er in ständigem Kontakt mit dem Theosophen. Dieser sollte derweil den Fall überprüfen und fuhr nach Yorkshire.
Gardner trifft die Familie und ist von der Aufrichtigkeit angetan. Die Eltern sind ehrbare Leute, die Mädchen offen und ehrlich. Die Fotos legt er mehreren Experten vor: einem Mr. Snelling, der schon seit Jahren im Fotogeschäft ist und bereits manchen Fälscher aufgedeckt hat. Mr. Snelling ist überzeugt, dass es sich bei den Fotos nicht um Fälschungen handelt. Gardner legt sie Fachleuten von Kodak vor, die sie für gelungen halten, sie wollen sich aber nicht festlegen. Sie behaupten indessen, ähnliche Fotos produzieren zu können. Interessanterweise kommt nun Widerstand aus den Reihen der Spiritisten. Ein Medium, das unter dem Pseudonym Mr. Lancaster tätig ist, will hier eine Fälschung entdeckt haben. Er sieht auch einen kleinen Mann mit zurückgekämmten Haaren, der mit seinen Fotos den Mädchen eine Freude machen wollte; er könnte etwas mit Dänemark oder Los Angeles zu tun haben. Gardner glaubt, dass das Medium einer Täuschung erlegen sei, andererseits aber passe die Beschreibung auf eben jenen Mr. Snelling, den Experten. Für Gardner stellen die Elfen eine parallele Evolution zur menschlichen dar, eine andere geistige Spezies, die mit Schmetterlingen und Motten verwandt sein könnte. Vielleicht, vermutet er, handelt es sich auch um die von dem Theosophen Leadbeater beobachteten Gedankenbilder. Das könnte erklären, warum die Elfen so sehr jenen Vorstellungen gleichen, die wir uns von ihnen machen. Es wären dann Materialisationen unserer Gedanken. Der Bauunternehmer macht sich geradezu zu einem Ethnologen der Elfenwelt: man kann ihre Kleidung und Kultur studieren wie die der Pygmäen oder Eskimo. Man achte nur auf die feinen Ornamente auf der Flöte! Die Wesen sind von subtilerer Materie als Gas, gehören zur Klasse der Lepidoptera und haben nur einen geringen Intellekt. Sie sind freudige Wesen und nehmen nur zeitweise menschliche Gestalt an. Sie strömen Emanationen aus, eine Erscheinung, die an den Federschmuck der Indianer erinnert. Sie nehmen Nahrung durch den Atem auf, etwa den Duft von Blumen, und tauchen in magnetische Bäder. Menschlicher Geruch dagegen stößt sie ab. Geburt, Tod und Sex in unserem Sinne kennen sie nicht. Statt sexueller Fortpflanzung teilen sie sich lieber wie Einzeller. Ihre Sprache besteht aus Gesten und ist auf der Höhe von Katzen, Hunden und Vögeln anzusiedeln. Ihre höheren Klassen sind dem Menschen gegenüber feindlich eingestellt. In Zukunft, hofft er, werde es jedoch zu Kooperationen zwischen dem Menschen und den Elfen kommen. Man könne dies auch einen bewussteren Umgang mit Naturkräften nennen.
Während Doyle auf der Südhalbkugel doziert, kann sein Kollege von neuen Fotos im Norden berichten. Gut auch, denn die Mädchen, so Gardner, würden bald in die Pubertät kommen und verlören dann ihre psychischen Fähigkeiten. „Eine wird sich mal verlieben – und dann – schwupp!“
Conan Doyle, der die Vorgänge 1921 in seinem Buch The Coming of the Fairies dokumentiert, spricht von einem neuen Kontinent, von dem wir bislang nicht durch einen Ozean, sondern durch subtile psychische Wände getrennt waren. Es werde der Tag kommen, an dem wir mit „psychischen Brillen“ jene Phänomene wahrnehmen könnten, die sich in einem anderen Schwingungsspektrum bewegten.
Die Öffentlichkeit ist aufgewacht und zeigt großes Interesse. Zeitungen bringen ausführliche Artikel oder schicken ihre Reporter nach Yorkshire. Den Wrights wird der Rummel zuviel und sie wünschen sich, nie wieder etwas von diesen Elfenfotos zu hören. Kritiker stellen viele Fragen, zu viele. Doch Gardner und Doyle können sie alle beantworten. Warum zum Beispiel gibt es keine richtigen Schatten auf den Elfen? Sie gehören einer Ordnung von leicht leuchtenden Körpern an, ähnlich wie das Ektoplasma, jene weiße Masse, die in Séancen oft aus den Medien tritt. Warum schaut Elsie nicht auf die Elfen, sondern in die Kamera? Die Kamera ist zu diesem Zeitpunkt viel interessanter für sie als die Elfen, mit denen sie ja auf vertrautem Fuß steht. Auf einen Einwand gehen die beiden nicht ein, aber Doyle gibt ihn zumindest wieder. Die Elfen tragen demnach eine Kleidung, die an Pariser Tanzhallen erinnert. Auch der Haarschnitt ist verdächtig modern. Sie schwingen ihre Beine nach der neuesten Mode, wie man es in Frankreich und Kalifornien tut. Bei solcher Bewegungslust stellt sich auch die Frage, wieso die Bilder so gut geworden sind. Nur mit einer sehr teuren Ausrüstung hätte man solch bewegte Wesen ohne Unschärfen auf die Platte bannen können. Doch in dieser Hinsicht verlassen sich die beiden auf den besagten Herrn Snelling, der ja die technische Korrektheit der Fotos bestätigt hat.
Die Fragen drehen sich zusehends um die beiden Mädchen, über die nun Widersprüchliches an die Öffentlichkeit kommt. So stellt sich etwa heraus, dass die Ältere in einem Fotoladen gearbeitet hat und jetzt in einer Manufaktur für Weihnachtskarten tätig ist. Außerdem ist es dubios, wenn Gardner die Sechzehnjährige als vorpubertär einstuft. Wiederum erscheint es den Verteidigern, dass es den beiden nicht möglich wäre, in einer halben Stunde solch perfekte Fälschungen zu produzieren. Ein Hellseher, der im Ersten Weltkrieg Panzer gefahren hat, geht nach Yorkshire, um die Dinge zu prüfen. Er schreitet mit den Mädchen durch das Tal und ist begeistert von ihrer Fähigkeit, Wassernymphen, Waldelfen, Wasserelfen und Kobolde zu sehen. Er kann das alles bestätigen, auch wenn er am Schluß noch ein unangenehmes elfisches Wesen antrifft. Ein Gentleman, dessen besonderes Hobby fotografische Fälschungen sind, schreibt, die Fotos seien zu achtzig Prozent echt. Man wirft die Fotos vergrößert auf eine Leinwand und wiederum kann der erfahrene Spezialist keine Spuren von Scherenschnitt oder dergleichen finden. 1921 sollen neue Aufnahmen mit einer besseren Kamera gemacht werden, doch der Sommer ist verregnet. Aufgrund einer neu entdeckten Kohleader ist das Tal auch in seinem Magnetismus gestört. Zudem sind die Mädchen inzwischen zu sehr gereift; sie können nicht mehr richtig materialisieren, meint der Theosoph, sondern höchstens noch hellsehen.
Doyle versammelt Berichte aus der Vergangenheit und Gegenwart, zitiert zahlreiche Korrespondenten und erinnert an Volkslegenden. Ein Elfenjäger, der im New Forest in einer Hütte wohnt, äußert die Ansicht, dass es verschiedene Elfenrassen gebe. So sah es auch schon der Reverend Kirk im Jahre 1680, der von den Stämmen und der politischen Ordnung der Elfen redete. Der Seher mit dem Pseudonym Lancaster sieht in ihnen „spirituelle Affen“; es sind Kinder wie Peter Pan, der nicht erwachsen sein will. Deshalb sind es gerade die Kinder, die sie am besten wahrnehmen können, was wiederum ein Leser aus San Antonio, Texas, bestätigt. Ein Korrespondent namens – ja – Holmes berichtet vom Elfenwesen auf der Isle of Man. Aus Neuseeland kommt der Hinweis auf reitende Elfen. Warum aber, so Doyle, reiten sie auf Pferden und nicht auf Hunden? Die Frage muss offen bleiben. Weitere Zeugen melden sich, so Mr. J. Foot Young, der bekannte Rutengänger oder Miss Eva Longbottom, eine charmante Vokalistin aus Bristol. In Australien trifft Conan Doyle Bischof Leadbeater, der mit Annie Besant zusammen die theosophische Vereinigung leitet, welche einen Messias namens Krishnamurti gekürt hat. Leadbeater weiß mehr über die Elfen als alle anderen und kann endlich auch eine Antwort auf Doyles Frage geben, ob die Elfen sich wie die Menschen von Land zu Land unterscheiden. Sie lautet emphatisch: ja! Aus der langen Liste nationaler Besonderheiten seien nur die farbigen und tanzenden Elfen Siziliens erwähnt, die goldbraunen Schotten, die smaragdgrünen Engländer, Belgier und Franzosen, die indigo-metallic-farbenen Bewohner Javas, die rosa-hellgrünen indischen Elfen, die schwarzgoldenen der Wüste sowie die Riesenelfen Irlands.
Für Doyle blieb ein Rest an Ungewissheit in dieser Affäre und er wandte sich lieber wieder dem Spiritismus und den Geisterfotografien zu. Hier fühlte er sich auf sicherem Terrain und veröffentlichte weitere Bücher, etwa über die Mitteilungen eines Geistes namens Pheneas, der große Katastrophen für Europa voraussagte. Gardner hielt an den Elfenfotos fest und noch 1945 widmete er der Angelegenheit ein Buch. Fast vierzig Jahre später, am 9. März 1983, veröffentlichte die Yorkshire Post die Mitteilung Elsies, die Fotos seien von den beiden Mädchen einst gefälscht worden. Aber warum hatte sie so lange mit dieser Offenbarung gewartet? Doyle und Gardner seien so liebenswerte Männer gewesen, dass man sie nicht hatte zum Narren halten wollen. Zu Lebzeiten beider konnte man nicht mit der Wahrheit herausrücken. Da Gardner gute 100 Jahre alt wurde, musste sie mit der Enthüllung etwas länger warten.
Wenn man sich heute die Fotos anschaut, ist man verwundert, wie solche doch recht primitiven Bilder die Welt so lange irreführen konnten. Man sieht förmlich wie die Papierfiguren, die zum Teil aus Princess Mary’s Gift Book von 1914 ausgeschnitten waren, mit Haarnadeln an die Pflanzen geheftet sind. Der stereotype Stil der edwardianischen Elfen ist aus heutiger Sicht sofort erkennbar. Auch nach der Enthüllung war die Affäre nicht beendet. 1994 sind zwei Filme darüber erschienen. Die Grenzen zwischen Realität und Fälschungsspuk sind dank special effects noch schwerer zu bestimmen. Weitere Elfenfotos sind produziert worden und werden immer mal wieder von Zeitungen abgedruckt. Die Fotos mögen Fälschungen sein, was sich über die Elfen nicht ohne weiteres sagen lässt.
Der Rückblick lässt allerdings auch den Detektiv nicht mehr ganz unberührt von irrationalen Erscheinungen. War Holmes ein Bollwerk gegen die Ausdünstungen der Unvernunft und des Übernatürlichen, so zeigen sich auch undichte Stellen in dieser starken Wand. Er hat ja nicht nur gelegentlich Kokain genommen und sich von seiner Violine in unerkannte Sphären tragen lassen. Dr. Watson entdeckte in Holmes‘ Artikel „Das Buch des Lebens“ ungereimte Absurditäten. Vergessen wir auch nicht, dass Holmes neben seinen Studien zu den 140 Arten von Tabakasche, zu Tätowierungen oder zur Bienenzucht unter dem norwegischen Pseudonym Sigerson den Bericht über einen zweijährigen Aufenthalt in Zentralasien, insbesondere Tibet, dem Heiligtum der Theosophie, hinterließ. Wir sollten die Vermutung wagen, dass Sherlock Holmes bei einem Lama in die Lehre gegangen ist.
Ein Beitrag von Prof. Elmar Schenkel
Literaturhinweise:
Arthur Conan Doyle, The Coming of the Fairies. London: Hodder and Stoughton 1922.
Edward L. Gardner, A Book of Real Fairies: the Cottingley photographs and their sequel. London: Theosophical Publishing House 1945, repr. 1984.
Joe Cooper, The Case of the Cottingley Fairies. London: Simon & Schuster 1990.
Diane Purkiss, Troublesome Things. A History of Fairies and Fairy Stories. London 2000.
Kelvin I. Jones, Conan Doyle and the Spirits. The spiritualist career of Sir Arthur Conan Doyle. Wellingborough: The Aquarian Press 1989.
Daniel Stashower, Teller of Tales. The Life of Arthur Conan Doyle. New York: Henry Holt 1999.
Stiegler, Bernd. Spuren, Elfen und andere Erscheinungen: Conan Doyle und die Fotografie. Frankfurt/M.: S. Fischer 2014.
Überarbeitete Version eines Essays, der in Elmar Schenkel, Die elektrische Himmelsleiter, München: C.H. Beck 2005, erstmals abgedruckt wurde.
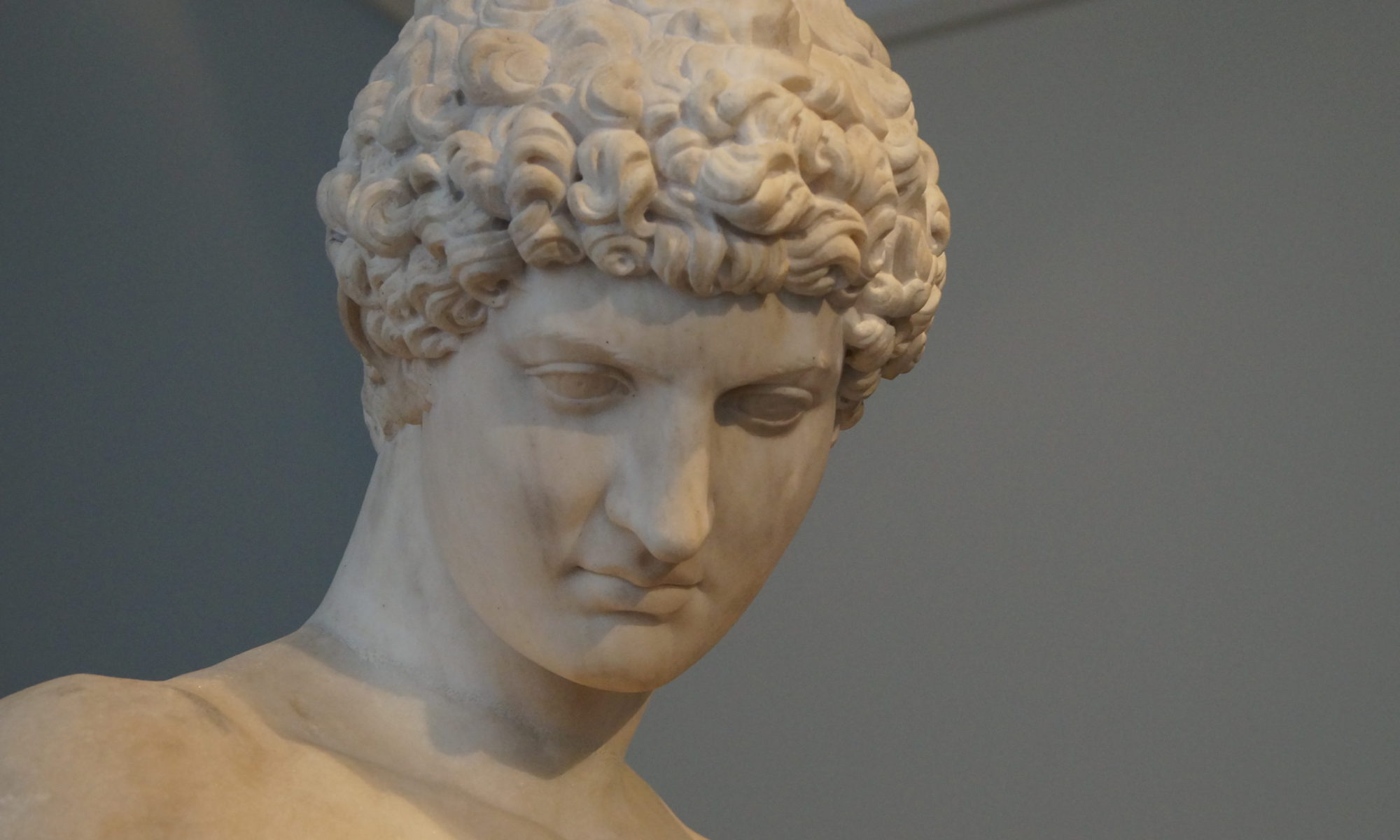

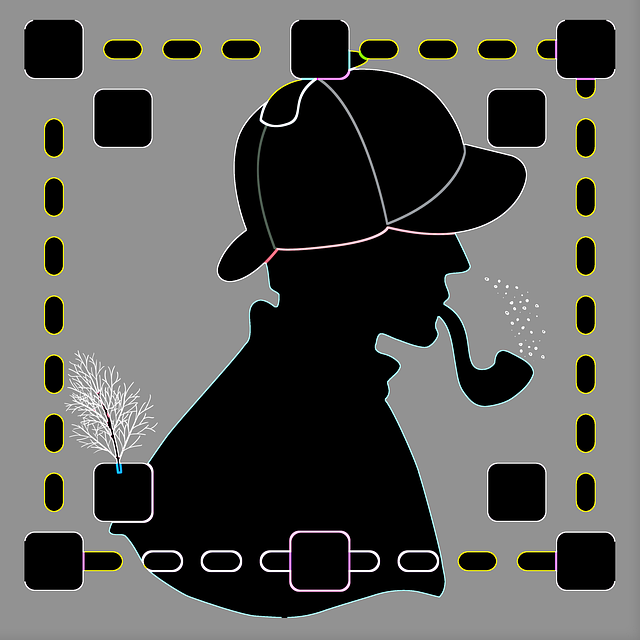
„Dass Doyle sich früh auch für spiritistische Phänomene wie Spukhäuser, Trancen, Medien und Séancen interessierte, war um die Jahrhundertwende gar nicht so ungewöhnlich, zumal auf den britischen Inseln“
In der griechischen Mythologie ist es so, dass Britannien nach Bretannos benannt wurde. Bretannos ist somit der Heros der britischen Inseln -> https://www.mythologie-antike.com/t1549-bretannos-mythologie-heros-von-britannien