Wenn wir der Wissenschaft glauben können, sind Exzentriker weniger krank als die anderen, die sich nicht für exzentrisch halten. Exzentrizität ist demnach wohl keine Krankheit. Andererseits kann Krankheit exzentrisch machen, sie kann einen hinauswerfen aus dem angestammten Lebenskreis, in dessen Mitte man zu sein glaubte. Sie kann Weltbilder in tausend Scherben schlagen und diese dann wieder neu zusammensetzen helfen. Sie kann eine Konversion einleiten, eine Wendung von Saulus zu Paulus. Swedenborg erfuhr solch einen Umsturz nicht als Krankheit, wohl aber als große Krise. Er hat ein Pendant in dem Leipziger Gelehrten Gustav Theodor Fechner, der in gewissem Sinne die Krise des Materialismus im 19. Jahrhundert am eigenen Leib erleben musste und sie auf fast wunderbare Weise für sich überwand.
1801 wurde er in Groß-Särchen in der Niederlausitz, im heutigen polnischen Zarki Wilkie, geboren, 1887 starb er in Leipzig. Er wuchs in einem Pfarrhaus auf und gehörte zu jenen zahlreichen Talenten, die aus protestantischen Pfarrersfamilien entsprungen sind – man denke an Lessing, Nietzsche oder die Geschwister Brontë und Powys in England. Der Vater war aufgeklärt und ließ als erster einen Blitzableiter an der Kirche anbringen, außerdem predigte er erschreckenderweise ohne Perücke und ließ seine Kinder impfen. Gustav Theodor studierte zunächst Medizin, musste aber bald feststellen, dass diese ihm nicht lag. Zumindest weckte die ungeliebte Wissenschaft seine satirischen Fähigkeiten und so schrieb er sich mit zwanzig seine Frustration vom Leib mit einer kleinen Schrift, die sich über den Jod-Kult der damaligen Medizin lustig macht: „Beweis, dass der Mond aus Jodine besteht.“ Seine eigentliche Begabung findet er in der Physik und Naturphilosophie. Er schrieb sich also in der Physik ein, aber sein Leben deckte sich nie hundertprozentig mit der Wissenschaft. So gelangte er in den Dunstkreis des, wie Fechner ihn nannte, „verdorbenen Genies“ Martin Gottlieb Schulze, eines Bohémien und Dichters, der es nie zu etwas brachte, dafür aber eine schwärmerisch-dämonische Existenz auslebte und auf seinen Bekanntenkreis einen großen Einfluss hatte. Mit ihm verachtete man die trockenen Wissenschaften und sah das Heil in der Kunst und Dichtung. Die destabilisierende Wirkung Schulzes soll Fechners Mutter dazu veranlasst haben, zu ihrem Sohn nach Leipzig zu ziehen. Schulze und Fechner blieben noch zwanzig Jahre in Kontakt, bis Schulze im Irrenhaus starb. Fechner war durch seinen Freundeskreis also romantisch eingestellt und etablierte sich zugleich in den positiven Wissenschaften, insbesondere der Physik.
Sein Arbeitspensum war enorm, vielleicht litt er unter Arbeitszwang. Dieser verbündete sich mit der Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Während er erste Vorlesungen hielt, schrieb er Bücher über Logik und Physiologie. Dazu übersetzte und bearbeitete er umfangreiche französische Fachbücher aus der Chemie und Physik. Sechzehn Jahre lang, bis 1838, schrieb Fechner jährlich etwa 1500 bis 2000 Druckseiten. Das sind mindestens fünf Seiten am Tag ohne Unterbrechung durch Feiertage und Ferien, und dies in einem Zeitalter, das noch nicht einmal Schreibmaschinen kannte. Dazu begründete er das „Pharmaceutische Central-Blatt“. 1835 richtete er außerdem das erste physikalische Institut an einer deutschen Universität ein. Er schrieb über Kampfer, Weinschwefelsäure, den Galvanismus und die elektrischen Eigenschaften des Holzes, über Magnetismus, den Schwefeläther oder die „Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts“, über Seifenbildung, elektrische Ströme und das Brom, die Zusammensetzung des Zuckers, über Schutzmittel gegen die Cholera und die Atomlehre sowie ein Lehrbuch über den Elektromagnetismus. Immer noch nicht genug: von 1832 bis 1834 arbeitete er mit an Brockhaus’ Conversationslexikon der neuesten Zeit und Literatur. Dabei ging es nicht um den einen oder anderen Artikel, sondern er schrieb gut ein Drittel des gesamten Lexikons selbst. So durfte der nicht besonders praktisch ausgewiesene Professor über die Tranchierkunst und die Anordnung von Speisetafeln referieren. Besonders wichtig aber ist, dass er sich eine literarische Ader erhielt. Er schrieb Satiren und spekulative Skizzen, die sich zwischen Wissenschaft, Religion und Scherz bewegen. Ich erwähne diese vielseitigen Tätigkeiten Fechners, weil sich hier zum einen eine unglaubliche Arbeitsleistung zeigt, die fast zwanghafte Züge trägt. Zum anderen deutet sich eine Diskrepanz an zwischen Wissenschaft und Phantasie. Seine literarischen Arbeiten, die er unter dem Namen Dr. Mises veröffentlicht, setzen sich sozusagen mit der anderen, wissenschaftlichen Hälfte seiner Person auseinander und werten die Wissenschaft in ihrer Bedeutung für das Leben. Wissenschaftliche Ideen über Zeit und Raum können wiederum gewinnbringend für phantastische Spekulationen eingesetzt werden. Imagination und Rationalität stehen hier also in einer sowohl fruchtbaren als auch spöttisch betrachteten Beziehung.
Dr. Mises schreibt zum Beispiel über die Zukunft des Menschen, die er in der Entwicklung des Engelhaften im Menschen sieht, das heißt in seiner Vervollkommnung. Wie aber sieht Vollkommenheit aus? In seiner Schrift über die „Vergleichende Anatomie der Engel“ stellt er fest, dass sie rund ist, eine Kugel ist ihre geometrische Gestalt. Mit anderen Worten, der Mensch wird sich zu einer Kugel entwickeln müssen. Wo aber ist die Vollkommenheit angesiedelt, wenn nicht im Kopf und in den Augen? Es ist also dieser Bereich, der sich weiter zu einer perfekten Kugel entwickeln wird. Oder er meditiert über den Schatten und dessen Lebendigkeit. Er macht sich über Hegel lustig, indem er mit hegelschen Mitteln nachweist, dass die Welt durch ein zerstörerisches Prinzip erschaffen wurde. Es ist ja nicht alles ernst gemeint, doch durch sein munteres und oft witziges Spekulieren entdeckt er auch Körner, in denen viel Zukunft verborgen ist. So in dem Aufsatz „Der Raum hat vier Dimensionen“. Über die vierte Dimension als einem übernatürlichen Raum wurde schon seit dem 17. Jahrhundert nachgedacht, aber Fechner könnte der erste gewesen sein, der diese vierte Dimension als Zeit definiert. Insofern darf man die Zeitmaschine, die H.G. Wells fünfzig Jahre später durch die Jahrtausende schicken wird, auf eine Idee des Leipziger Forschers zurückführen. Mit der vierten Dimension kam er später noch einmal in Berührung, als das amerikanische Medium Henry Slade Leipzig besuchte und im Hause des Kollegen Karl Friedrich Zöllner (Astrophysiker und Spiritist) Vorführungen veranstaltete, bei denen er angeblich die vierte Dimension durchquerte. Er knotete ein Seil so, wie man es nur kann, wenn man die Dimension wechselt. Außerdem zeigte er andere Fähigkeiten wie Telepathie und Telekinese. Zöllner wie auch Conan Doyle verteidigten diesen Zauberer in gewichtigen Schriften, Fechner war als Zeuge zwar anwesend, hielt sich in seinem Urteil aber zurück. Er blieb skeptisch und das war besser, denn Slade war in England schon als Trickbetrüger entlarvt worden und befand sich auf der Flucht vor der Strafverfolgung. Fechner war generell vorsichtig gegenüber Behauptungen übernatürlicher Art. Bei all seiner späteren Mystik wahrte er immer kritische Distanz zu den Phänomenen, wenn er sich in der Rolle des Wissenschaftlers befand.
Fechner hatte aber eine spekulative Lust von der Art, die es auch Einstein ermöglichen sollte, sich ein gänzlich neues Weltbild vorzustellen, in dem sich Zeit und Raum zusammenschließen. Seine literarischen Interessen kultivierte er weiterhin in Artikeln über Rückert und Heine. Begegnungen mit Bettina von Arnim und Adelbert von Chamisso oder auch ein Brief an den bewunderten Jean Paul zeigen, wie viel ihm Literatur bedeutete. Im selben Jahr, in dem er zum Professor berufen wurde, 1833, heiratete er Clara Volkmann. Die Ehe blieb kinderlos, aber die beiden adoptierten einen Pflegesohn.
Unermüdlich arbeitete Fechner weiter, doch im Jahre 1839 schlägt ihn eine schwere Krankheit. Sie entspringt der Wissenschaft. Er hatte sich in dieser Zeit intensiv mit Experimenten beschäftigt, in denen er die Störungen des Farbsehens durch starke Sonnenblendung untersuchen wollte. Dazu mussten mit Hilfe eines engen Diopterloches genaue Messungen angestellt werden. Die Überanstrengung führt zunächst zu einer Sehschwäche und Lichtscheu, weitet sich aber bald aus. Er kann nur noch durch blaue Brillengläser sehen, die später durch Sonnenblenden ersetzt werden müssen. Aber es ist nicht nur ein Versagen der visuellen Kräfte; es schlägt sich vielmehr auch auf seine Psyche und Intelligenz nieder. Er kann nicht mehr lesen und schreiben und verliert die Kontrolle über seine Gedanken und Assoziationen. Er hat das Gefühl gespalten zu sein zwischen Assoziationen und dem Ich und empfindet dies als einen Kampf zwischen Roß und Reiter oder einem Prinz und seinem rebellischen Volk. Die Ärzte wissen sich bald keinen Rat mehr. Eine Behandlung mit brennenden Kegeln, die das Übel aus ihm herausbringen sollen, macht alles nur noch schlimmer. Nun versagen auch Appetit und Verdauung. Er scheint ein hoffnungsloser Fall geworden zu sein, der zudem dabei ist zu verhungern. Auch die Universität gibt ihn auf und überlässt dem Physiker Weber seine Stelle, aber zahlt ihm immerhin sein Gehalt weiter.
Die ganze Stadt, in der der der große Gelehrte geehrt und geliebt wird, nimmt Anteil an seinem Schicksal. Aus der mitfühlenden Stadt kommt schließlich Hilfe, der erste Schritt zur Heilung. Eine entfernt mit ihm bekannte Leipzigerin hat einen Traum, in dem ihr ein Rezept mitgeteilt wird, das ihm helfen könnte. Sie träumt von rohem Schinken, in Wein eingelegt, gewürzt und mit Zitronensaft übergossen. Der Schinken wird Fechner überbracht und oh Wunder, er kann ihn goutieren. Von nun an erhält er regelmäßig die so zubereitete Speise und sie hilft ihm, wieder Grund in seinem Körper zu fassen. Doch die Seele ist damit noch nicht gerettet. Kopfschmerzen, extreme Langeweile, gedankliche Zerfaserung gehen weiter, ja nehmen noch zu. Er sitzt nun in einem schwarzen Zimmer, man liest ihm vor durch eine trichterförmige Öffnung in der Tür. Bald kann er nicht mehr zuhören, zupft am Stoff, dreht Schnürchen, schneidet Späne, Möhren und Bücher, wickelt Garn oder stößt Zucker für den Haushalt. Seine Augen sind verbunden, doch auch das reicht nicht mehr, er erhält eine Gesichtsmaske aus Metall. Er kann nicht einmal mehr mit seiner Frau reden: „So saßen wir bei Tische, wo ich mit der Maske Platz nahm, oft fast stumm zusammen.“ Er geht draußen mit der Maske spazieren und singt darunter Lieder von Eichendorff. Die Augen sind es schließlich, die ihn aus dieser Misere wieder befreien werden, als sei seine „Vergleichende Anatomie der Engel“ von 1825, in denen er die Rolle des Auges so betont hatte, eine Prophezeiung gewesen. Es beginnt mit den Versuchen, unter der Maske zu blinzeln, schließlich die Augen zu öffnen und die Gegenstände gleichsam mit den Augen zu verschlingen. Er trinkt literweise Milch, wie ein Neugeborener, schreibt Gerd Mattenklott. Wie ein Neugeborener entdeckt er jetzt auch die Welt wieder: sie ist ein Wunder.
Dieses Wunder hat mit Lust zu tun. Sein erstes größeres Werk nach der Heilung ist ein Werk über das höchste Gut: eben die Lust. Alle menschlichen Regungen bis hin zur Schöpfung selbst verdanken sich dem Lustprinzip. Die Wissenschaft hat er nicht aufgegeben, aber sie wird nun Teil eines umfassenderen, philosophischen Weltbildes. Es werden noch Veröffentlichungen zur Psychometrie, über das Verhältnis von weiblicher zu männlicher Schrittgröße oder zur Atomistik kommen. Als einer der ersten empirischen, das heißt messenden Psychologen wird er sich weltweit einen Namen machen, und etwa großen Einfluss auf den Pragmatismus des Amerikaners William James haben.
Aber seine eigentlichen Hauptwerke tragen nun seltsame Namen: Nanna oder Zend-Avesta. In Nanna, benannt nach der nordischen Blumengöttin,erforscht er das Seelenleben der Pflanzen. In Zend-Avesta erscheint der Kosmos als ein Bewusstsein, das aus mannigfachen Stufen besteht, der Tod als Übergang in einen jenseitigen Leib. Man hat in ihm einen grünen Denker gesehen (in den achtziger Jahren), weil er die Vernetzung der Natur und der Menschen erkannt hat und die Erde einen lebendigen Organismus nannte. Man sah in ihm ebenso einen Vordenker der Computerwelt (in den neunziger Jahren). In einer frühen Schrift über das Leben nach dem Tod, als er noch materialistisch dachte, träumte er davon, dass das erworbene Geistige im Jenseits weiterlebt. So stellen sich heute amerikanische Computerpioniere wie Hans Moravec oder Ray Kurzweil vor, man könne die Programme, die ein Lebender erzeugt habe, nach seinem Tod auf eine neue Hardware übertragen.
Fechner spielte gerne mit Gedanken und in einem leichtfüßigen Artikel stellte er sich einmal vor, wie es wäre, wenn die Zeit rückwärtslaufen würde: ein Gedanke, der erst vom Film realisiert werden sollte. Folgen wir dieser Phantasie, dann stünde am Schluss dieses kleinen Porträts nicht der Tod, sondern die Geburt von Gustav Theodor Fechner. Fechner, so müssen wir nun schreiben, starb zunächst im Jahre 1887, dann wurde er im Jahre 1801 geboren. Aber das wäre noch nicht richtig, denn aus dem Tod müsste nun ja eine Geburt zurück ins Leben werden, aus der Geburt eine Art Tod in das Dasein vor der Geburt und Zeugung. Also müssten wir sagen, Fechner wurde 1887 in Leipzig geboren und starb im Jahre 1801 in der Niederlausitz. Fechner wohnte in der Leipziger Scherlstraße. Einer seiner Nachbarn war der Student Friedrich Nietzsche. Von einer Begegnung beider ist leider nichts bekannt.
Ein Beitrag von Prof. Elmar Schenkel
Literaturhinweise:
Michael Heidelberger, Die innere Seite der Natur. Gustav Theodor Fechners wissenschaftlich-philosophische Weltauffassung. Frankfurt/M.: Vittorio Klostermann 1993.
Kurd Lasswitz, Gustav Theodor Fechner. Stuttgart: Friedrich Frommann 1896.
Gert Mattenklott, Blindgänger. Physiognomische Essays. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986.
Hans-Peter Waldrich, Grenzgänger der Wissenschaft. München: Kösel 1993.
http://www.uni-leipzig.de/~fechner/bio5.html Zugriff 6.5. 2020
© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.
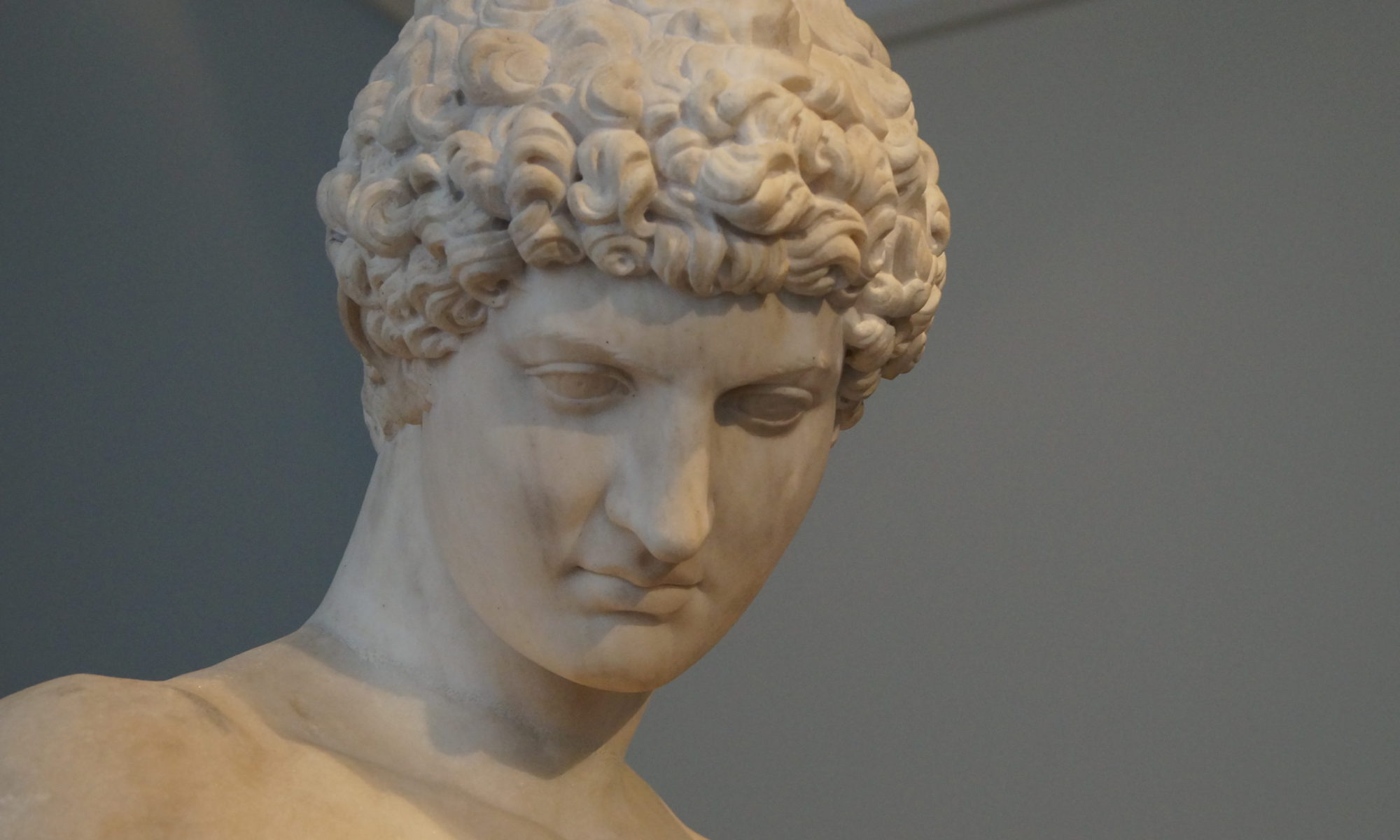

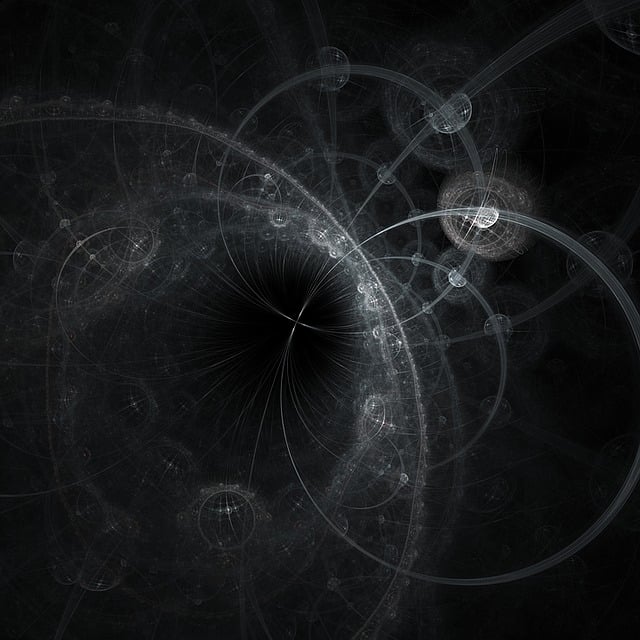
„Mit anderen Worten, der Mensch wird sich zu einer Kugel entwickeln müssen“
Gemäß Platon gab es einst Kugelmenschen mit der Bezeichnung Androgynos ->
https://www.mythologie-antike.com/t526-androgynos-mythologie-der-mannweibliche